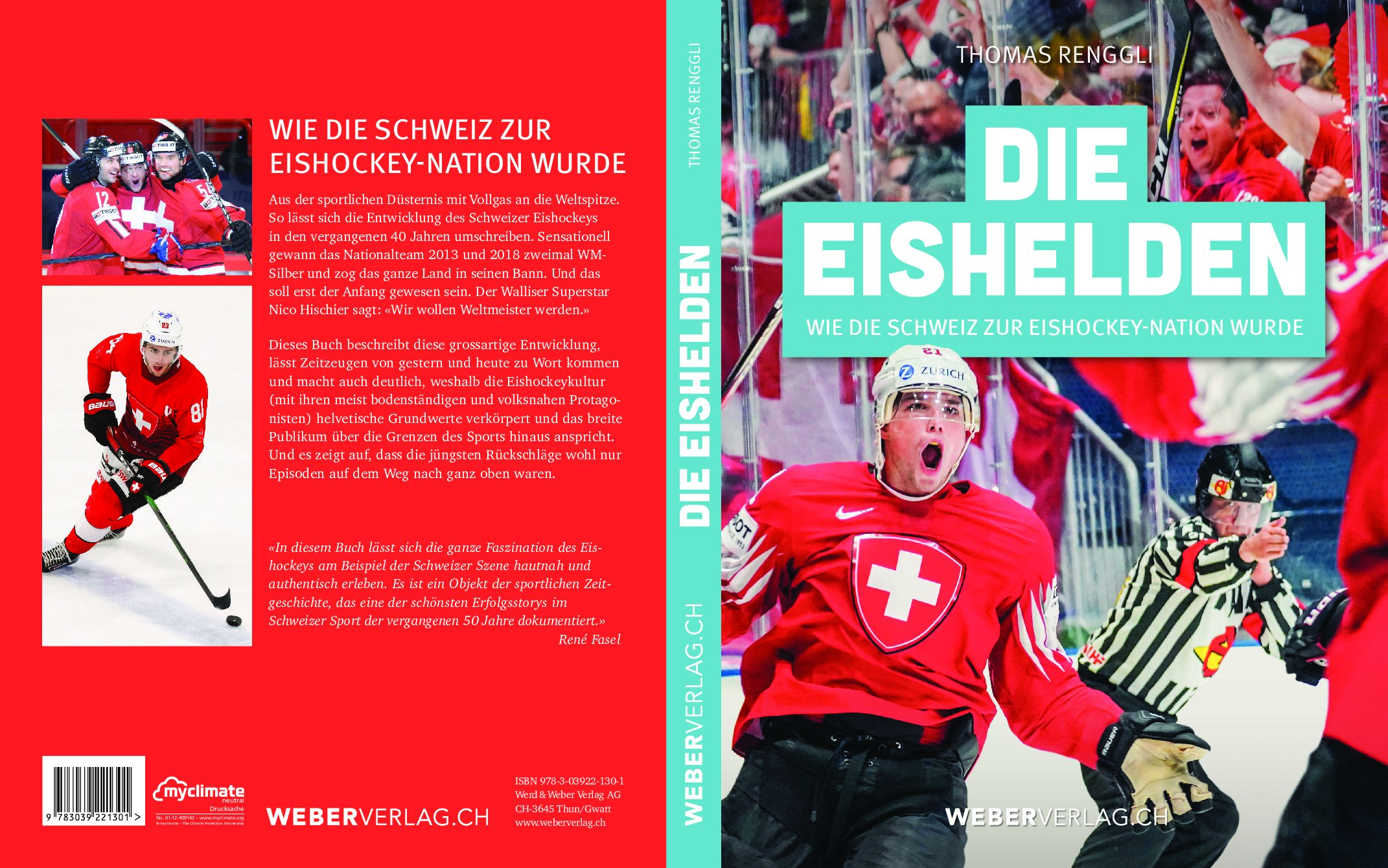Gipfel der Kulturen. Am SI-Stammtisch in Freiburg unterhalten sich Bundespräsident Guy Parmelin, Stiftungsgründerin Sonja Dinner und Eishockeystar Slawa Bykow über Integration, Covid und die Zweisprachigkeit. Der gebürtige Russe Bykow sagt, weshalb er sich heute auch als Schweizer fühlt.
Text: Thomas Renggli Fotos: Kurt Reichenbach
Die Pinte de Trois Canards liegt im Galterntal (im Vallé du Gottéron), einem mystischen und sagenumwobenen Ort. Das Sonnenlicht berührt den Talboden hier kaum. Schroffe Felswände zeigen dem Menschen die natürlichen Grenzen. Der Legende nach soll hier der Drache schlafen, der dem Hockeyclub Gottéron den Namen gegeben und das Feuer der Leidenschaft eingeflösst hat. Doch auch die Gaststätte selber animiert zu Fantasien und Fabelerzählungen. Sie erinnert an die Üechtländer Antwort auf das Wirtshaus im Spessart, wo sich Halunken, Wegelagerer und andere dunkle Gestalten verabredeten.
An diesem Montag trifft sich im Trois Canards anlässlich des achten Stammtisches von SI/Illustré eine hochrespektable Runde. Bundespräsident Guy Parmelin, 61, Eishockeylegende Slawa Bykow, 61, der Freiburger Staatsratspräsident Jean-François Steiert, 60, Sonja Dinner, 58, von der Stiftung Dear Solidarité Suisse, der 25-jährige Geschichtsstudent Jakob Spengler (Schmitten) sowie die Studentinnen der Medien- und Kommunikationswissenschaft Lisa Willener (19, Homberg) und Anic Marchand (21, Villars sur Glâne).
SI-Co-Chefredaktor Werner De Schepper übernimmt die Gesprächsleitung – wie es sich hart am Röschtigraben gehört bilingue. Gekonnt spielte er den ersten Steilpass – mit der Bemerkung, dass Steiert der verständlichkeitshalber bitte nicht Senslerdeutsch sprechen soll.
Monsieur Bundespräsident Parmelin, was haben Sie heute Morgen gemacht?
Parmelin: Ich bin aus meinem Heimtatort Bursins nah Bern gefahren und ins Büro gekommen. Wir hatten die gewohnte Montagmorgensitzung, an der wir das Wochenende Revue passieren lassen und auf die kommende Woche vorausblicken. Dann folgte ein Sitzung des Bundesamts für Landwirtschaft, an der wir verschiedene Dossiers behandelten und das weitere Vorgehen besprachen. Ausserdem fand das erste Vorbereitungsmeeting für die Bundesratssitzung vom Mittwoch statt. Da haben wir die Themen jeweils in verschiedene Prioritätenlisten sortiert – die orange, mit den Dossiers, bei denen keine besonderen Probleme bestehen; die weisse Liste, mit Themen, die man intensiver diskutieren muss, bei denen die Entscheidungsfindung offen ist, und die grüne, bei der es schwierig wird.
Gibt es ein wichtiges Dossier, das die Studenten betrifft?
Vielleicht nicht die Studenten direkt, aber Themen, die sich generell um die Zukunftsgestaltung drehen. Beispielsweise behandeln wir die Sozialversicherungen – und die Frage, wie in Zukunft mit dieser Thematik umzugehen ist. Da nehmen wir Vorschläge auf, besprechen Eckpunkte und stellen uns die Frage, wie wir eine Botschaft formulieren, die dann in die Vernehmlassung geht. Und da ist natürlich die allgegenwärtige Corona-Thematik. Grundsätzlich kann ich sagen: Eine Sitzung ohne Covid19 hatten wir wohl seit zwei Jahre nicht mehr – und natürlich wird die Impffrage intensiv besprochen.
Bykow: Ich bin gebürtiger Russe. Und ich habe mich für die Impfung mit Sputnik V entschieden, weil es kein Schweizer Produkt gibt. Es wäre schön, wenn der russische Impfstoff auch in der Schweiz bald akzeptiert wird.
Parmelin: Das ist ein rollender Prozess, der auch mit den europäischen Gesundheitsbehörden zusammenhängt. In der Schweiz akzeptieren wir nur Impfstoffe, die von der europäischen Arzneimittelagentur zugelassen werden. Und das gilt für Sputnik bis jetzt nicht.
Bykow: Aber Russland war bei der Impfstoff-Produktion immer führend. Seit ich ein Kind war, habe ich unzählige Impfungen erhalten – und nie ein Problem damit bekundet. Es ist schwer nachvollziehbar, dass ausgerechnet während dieser Krise die Politik über die Gesundheit gestellt wird.
Steiert: Ich habe mich wie alle Mitglieder der Freiburger Regierung impfen lassen, weil ich der Meinung bin, dass wir nur so aus der Krise kommen. Mein Credo ist: möglichst wenig Zwang und möglichst viele Gelegenheit zum sozialen Austausch. Denn für die Psyche der Menschen ist der soziale Kontakt entscheidend. Grundsätzlich kann man sagen: das Krisenmanagement in Covid-Zeiten ist die permanente Suche nach dem Gleichgewicht zwischen gesellschaftlichen, medizinischen, psychischen und wirtschaftlichen Interessen.
Marchand: Ich habe Mühe mit dem Druck, der ausgeübt wird. Und dieser kommt nicht vom Bundesrat oder von den Behörden, sondern bei uns in Freiburg von der Universität und vom persönlichen Umfeld. Ich bin grundsätzlich bereit, mich impfen zu lassen, aber ich möchte selber entscheiden können, ob und wann ich es tue. Wenn ich den Freiraum hätte, mich zu entscheiden, wäre ich vermutlich schon geimpft. Aber so warte ich noch ab.
Spengler: Ich liess mich schon im Februar impfen, weil ich in einem Altersheim arbeite. Für mich stellte sich die Frage nach dem Freiraum nicht im gleichen Zusammenhang wie bei Anic. Für mich eröffnet die Impfung neue Freiräume.
Willener: Bei mir ist es wie bei Anic. Ich habe Mühe, wenn Druck aufgebaut wird – und man zu etwas gedrängt wird, von dem man nicht überzeugt ist.
Steiert: Es ist immer ein Abwägen. Es geht um die Gewichtung zwischen kollektivem Interesse und persönlicher Freiheit. Dazwischen gibt es nicht nur Weiss und Schwarz. Man führte ähnliche Diskussionen zu anderen Impfungen wie Röteln oder Masern – aber damals wesentlich weniger hitzig. Dazu kommt der soziale Aspekt: Viele Junge sind während der Pandemie depressiv geworden. Gerade, wenn man mit dem Studium beginnt und die Mitkommilitonen nicht treffen kann, fühlen sich viele alleine gelassen. Wir werden noch lange mit den Folgen von Long-Covid zu kämpfen haben – vor allem mit den psychischen Folgen. Aber zurück zur Impfung: Ich bin persönlich vom Impfstoff überzeugt. Wir haben die Richtlinien aber immer so versucht zu legen, dass man sich testen lassen kann, wenn man die Impfung nicht will.
Sonja Dinner, Sie waren ein der ersten, die vor wirtschaftlichen und mentalen Folgen der Pandemie gewarnt hatten…
Dinner: Die Entwicklung hat mich nicht wirklich überrascht. Vielleicht bin ich in dieser Beziehung von meiner internationalen Arbeit geprägt – und den Erfahrungen mit Seuchen wie Dengue-Fieber, Ebola, oder Malaria. Pandemien halten sich nicht an Parteiprogramme. Und bei Covid handelt es sich nicht nur um eine Pandemie. Das Virus hat tausende Gesichter: medizinisch, wirtschaftlich, mental. Meine Sorge war es, dass sich die Schweiz lange nicht erholen wird. Ganz so schlimm ist es nicht gekommen. Beispielsweise im Tourismus haben sich die Menschen angepasst. Viele gehen nun in der Schweiz in die Ferien. In anderen Bereiche wie Gastronomie, Kunst oder Unterhaltung ist eine allmähliche Erholung spürbar. Wiederum andere Branchen aber werden sich nie ganz erholen. Dabei hatten wir noch nie so viel Geld in der Schweiz wie jetzt. Die Solidarität muss noch besser spielen.
Parmelin: Ich bin der Meinung, dass wir den Gedanken der Solidarität in der Schweiz gut ausleben – und die Massnahmen gut dosieren. Beispielsweise waren wir das einzige Land, das die Schulen nur 15 Tage geschlossen hatte. Grundsätzlich geht es immer um individuelle Lösungen. Gewisse Branchen muss man intensiver begleiten als andere. Und die Jungen darf man nicht alleine lassen. Doch die Wirtschaft wird nach Covid nicht mehr die gleiche sein wie vorher. Nehmen wir das Beispiel der Gastronomie. Weil viele Firmen auf Homeoffice setzten, werden die Menschen am Mittag nicht mehr fünfmal pro Woche im Restaurant essen. Wir müssen lernen, mit der neuen Situation umzugehen.
Slawa Bykow, was hat die Pandemie mit dem Sport und mit den Jungen im Sport gemacht?
Bykow: Für viele junge Mannschaftssportler war es eine traurige Zeit. Das Geschäftsleben kann man digital organisieren. Aber im Sport gibt es kein Homeoffice. Der Sport im Allgemeinen und das Eishockey im Speziellen funktionieren nur im Kollektiv. Nur gemeinsam kommt man ans Ziel. So ist der Sport für mich wie eine positive Droge. Er ist gut für die Gesundheit, er ist gut für Gesellschaft, er ist gut für die Psyche. Aber wenn man nicht mehr mit den Kollegen spielen kann, bleibt vieles auf der Strecke. Der Sport war für mich aber auch immer ein Mittel zur Integration. Vor allem durch das Eishockey habe ich mich in der Schweiz schnell wohl gefühlt – und hier meine zweite Heimat gefunden. Ich bin dankbar, dass mich die Schweiz mit derart offenen Armen empfangen hat. Deshalb möchte ich nun auch etwas zurückgeben.
Willener: Auch für mich ist der Sport sehr wichtig. Ich spiele Unihockey.
Bykow: Das ist grossartig – fast so gut wie Eishockey (lacht).
Willener: Mein Vater hat diesen Sport schon gespielt. Ich spüre auch, dass man von Teamsport kaum mehr loskommt, wenn man diese Erfahrung einmal machen konnte. Als wir während der Pandemie plötzlich nicht mehr gemeinsam trainieren konnten, fehlte das wichtigste. Ich vermisste meine Teamkolleginnen. Wenn man alleine trainieren muss, entfällt die gegenseitige Motivation und die kollektive Freude.
Bykow: Der Effekt, dass man sich gegenseitige Energie vermitteln kann, wird im Sport intensiv spürbar. Und man lernt, Ziele zu fixieren – und sie dann zu erreichen.
Marchand: Wenn wir von Zielen und Lösungen sprechen, möchte ich Herrn Parmelin etwas sagen: Ich habe den grössten Respekt vor dem Bundesrat. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen machen eine grossartige Arbeit. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, denn sie müssen unter einem gewaltigen Druck stehen. Mich würde es interessieren, wie sie die Pandemie als private Person erlebt haben.
Parmelin: Als Bundesrat muss man Entscheidungen treffen, die alle angehen. Es ist unglaublich, wie viele Personen plötzlich unsere Medienkonferenzen verfolgen. Neulich wurde ich von einem achtjährigen Mädchen angesprochen, dass sie jede Medienkonferenz anschaut. Im Bundesrat sind wir sieben Personen – mit verschiedenen Meinungen. Wir wollten immer Entscheidungen treffen, die den Menschen schnell helfen und das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Instanzen wahren. Als es um die Kurzarbeit ging, haben wir beispielsweise eine Lösung für die Selbständigen gesucht. Dann kamen die Schausteller – oder die Taxifahrer, die zwar kein Berufsverbot hatten, aber selber auch schwer betroffen waren. Das war dramatisch. Wir erhielten auch viele persönliche Briefe, die das Ausmass der Krise dokumentiert haben. Aber ich glaube auch, dass wir es im internationalen Vergleich nicht so schlecht gemacht haben. Und grossen Dank an Frau Dinner, dass Sie das System mit Ihrer Stiftung komplettieren.
Dinner: Aber trotzdem sind viele Branchen, aber auch Einzelschicksale durch die Maschen gefallen. Deshalb müssen wir die Solidarität weiter fördern. Ich ermutige alle Menschen, flexibel zu sein – und nicht unnötig an Dingen und Mustern festzuhalten. Aber es gibt viele Menschen, die keine Wahl haben – weil sie nicht so einfach einen anderen Beruf lernen können. Da müssen wir als Gesellschaft ein Auffangnetz bieten.
Parmelin: Es gibt viele Einzelschickschale. Das spüren wir auch im Bundesrat. Beispielsweise habe ich ein Mail von einer wütenden Person erhalten, die einen Take-away-Betrieb führt. Der dortige Kanton hat entschieden, dass dieses Unternehmen ab 16 Uhr nicht mehr arbeiten darf – also genau in jener Zeit, in der es die grössten Umsätze macht. Dann habe ich den Kontakt mit dem entsprechenden Kanton aufgenommen – und die Antwort erhalten, dass man den Apero ja auch an einem anderen Ort einnehmen kann. Das ist schwer nachvollziehbar.
Dinner: Wir arbeiten mit Organisationen und Berufs-Verbänden zusammen, die mit Unterstützungsgesuchen an uns gelangen. Zum Beispiel stark betroffenen Berufsgruppen und Organisationen, die arbeitslose Jugendliche und Über-50-Jährige unterstützen oder allerziehende Väter und Mütter. So haben wir verschiedene Modelle für unterschiedliche Berufsgruppen, die besonders stark betroffen sind.
Steiert: Man muss sich im Krisenmanagement immer an den Kleinen orientieren. Aber man muss auch uns Politiker verstehen. Normalerweise dauern die Entscheidungsprozesse mehrere Jahre. Nun müssen wir innerhalb kurzer Zeit Lösungen finden. Wir müssen als Kantone extrem schnell entscheiden – ohne immer sicher zu sein, dass wir richtig liegen, weil das Wissen zum Teil noch nicht exisitiert. Das ganze Vernehmlassungverfahren, das die Schweizer Kultur pflegt, ist faktisch ausser Kraft. Man hat keine Zeit mehr, mit den Leuten vorgängig zu sprechen. Wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, werde ich oft von Menschen angesprochen – und muss auch Fehler eingestehen. In der Pandemie ist in unserer politischen Arbeit viel Präzision verlorengegangen. Früher hatten wir in der Schweizer Politik quasi eine Uhrmacherkultur. Aber heute ist diese oft nicht mehr möglich.
Willener: Herr Bundespräsident. Was mich interessieren würde, ist die Testsituation. Wenn ich in Bern studieren würde, müsste ich für die Tests nicht bezahlen – in Fribourg aber schon. Könnte man dies nicht schweizweit gleich handhaben?
Parmelin: Das ist unser Föderalismus. Der Bundesrat hat entschieden, dass die Tests so lange gratis sind, bis sich alle impfen lassen konnten. Nun haben wir entschieden: entweder Impfung oder bezahlter Test. Denn man kann nicht immer alles auf den Steuerzahler abwälzen. Aber grundsätzlich muss ich sagen: Die Tests können helfen, um aus der Pandemie zu kommen. Aber am Schluss braucht es die Impfung. Und da gibt es in einigen Regionen Nachholbedarf. Heute habe ich beispielsweise gehört, dass im Entlebuch nur 20 Prozent der Bevölkerung geimpft sind.
Wie beurteilen Sie die Stimmung in der Bevölkerung. Gerade die Impffrage wird mit einer unschweizerischen Heftigkeit geführt…
Parmelin: Man darf scharf diskutieren, aber man muss zuhören – und den Anstand wahren. Die Aggressivität, mit der die Debatte an gewissen Orten geführt wird, ist nicht akzeptabel. Denn in der Schweiz besitzt jeder ein Mitspracherecht. Wir können mindestens viermal pro Jahr über alle Themen abstimmen. Ich bin in den sozialen Medien nicht präsent. Aber wenn ich teilweise höre, was dort kommuniziert wird, stimmt mich das nachdenklich. Grundsätzlich bewege ich mich aber noch so frei im wie vor der Pandemie. Und es gibt auch heitere Erlebnisse. Neulich war ich in einem Spital in Avignon – und wurde bei der Registrierung erkannt. Da hat mich der Mann gefragt, ob ich immer noch Bauer sei. Ich habe geantwortet: Nein, ich bin jetzt Bundesrat. Da kam die Frage: Was ist ein Bundesrat?
Bykow: In Russland würde man nie so einfach mit einem Politiker in Kontakt kommen. Unsere Minister sind quasi unberührbar. Dank meinem Status als Nationaltrainer hatte ich aber das Privileg, Vladimir Putin mehrmals zu treffen. Dabei ging es um die Entwicklung im Sport im Allgemeinen und im Eishockey im Speziellen. Es waren immer sehr teamorientierte, konstruktive und produktive Gespräche. Ich bin ihm sehr dankbar, was er für den Sport geleitet hat.
Parmelin: Ich traf ihn am Rande des Gipfels mit Joe Biden in Genf.
Bykow: Was mir an Putin besonders imponiert: Er ist immer sehr gut informiert über seine jeweiligen Gesprächspartner und die Branche, in denen sie sich bewegen. Im Eishockey beispielsweise kennt er alle Details. Und er hat es in unserem Sport noch auf ein akzeptables Niveau gebracht – obwohl er erst mit 50 damit begonnen hat.
Herr Bykow, sie sind seit 2003 Schweizer Staatsbürger. Aber ihre Wurzeln liegen in Russland. Wo möchten Sie alt werden?
Bykow: Wir sind am 4. Juli 1990 in die Schweiz gekommen – fast schon symbolhaft am Tag der amerikanischen Unabhängigkeit. Unsere Kinder Masha und Andrei waren damals 6 und 2 Jahre alt. Sie haben ihre ganze Kindheit und Jugend in der Schweiz verbracht – und leben mittlerweile mit ihren eigenen Familien. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, die Kinder zu begleiten, bis sie selbstständig sind und wissen, wohin ihr Weg führt. Als schweizerisch-russische Doppelbürger haben auch sie die Wahl zwischen den beiden Ländern. Bis die Kinder wissen, was sie wollen, werden wir in der Schweiz bleiben. Aber danach sind die Türen in beide Richtungen offen. Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass in der Zukunft vieles möglich ist.
Spengler: Ich würde gerne noch Herrn Steiert etwas fragen. Sie kündigten unlängst an, dass der Finanzplatz Freiburg dem Volk und der Allgemeinheit dienen soll. Doch gemäss den Pandora-Papers ist er ein Hotspot für Briefkastenfirmen. Finden Sie das okay?
Steiert: Wir sind einer der Kantone, die am meisten Pendler haben – weil wir zu wenige Arbeitsplätze für hochqualifiziertes Personal haben. Wir müssen Jobs schaffen, die für gut ausgebildete Junge passend sind. Meine Priorität ist es ganz klar, solche Stellen zu schaffen. Briefkastenfirmen dagegen bringen praktisch keine Arbeitsplätze. Aber es gibt immer noch die These, dass ein starker Steuerwettbewerb gut für die Wirtschaft ist. Ich teile diese Meinung nur sehr bedingt. Am Schluss hat man Firmen, die nur wegen den Steuern hier sind – und dann weiterziehen. Vielmehr müssen wir in die Forschung investieren. Das ist nachhaltig. Briefkastenfirmen sind sehr volatil. Wenn wir nicht aufpassen, wen wir reinholen, haben wir früher oder später ein Problem.
Dinner: Da bin ich mit den Sozialdemokraten absolut einig. Ich bin der Meinung, dass man an jenem Ort die Steuern bezahlen und Einkaufen soll, wo man lebt. Auch hier geht es um Solidarität. Wenn jemand einen Schweizer Lohn bezieht, soll man dazu beitragen, dass die Mitmenschen ebenfalls Schweizer Löhne beziehen.
Wir sitzen hier Mitten im Röschtigraben – aber die Zweisprachigkeit wird im Kanton Freiburg nicht mit letzter Konsequenz umgesetzt – weder an Schulen noch bei den Behörden….
Steiert: Es ist paradox. Der Anteil der Deutschsprachigen in der Stadt Freiburg hat abgenommen. Aber in der subjektiven Wahrnehmung der französischsprachigen Bevölkerung hat er zugenommen. Im Wahlkampf habe ich auf meiner Visitenkarte aufgeführt, dass ich zweisprachig bin. Da ist eine ältere Frau zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich diese Information besser entfernen sollte. Sie könnte mir schaden. Wir werden Koexistenz der beiden Kulturen nur dann optimieren, wenn wir gemeinsame Projekte umsetzen. Auch der Sport kann da eine Rolle übernehmen. In der Garderobe werden zwei Sprachen gesprochen. Man kann den Röschtigraben als Graben sehen – oder als Begegnungszone der Kulturen.
Bykow: Ich habe den Röschtigraben vor allem dann bemerkt, wenn wir gegen den SC Bern gespielt haben. Aber deswegen sind wir Russen in die Schweiz gekommen – um die Menschen zu verbinden und die Gräben zu schliessen.